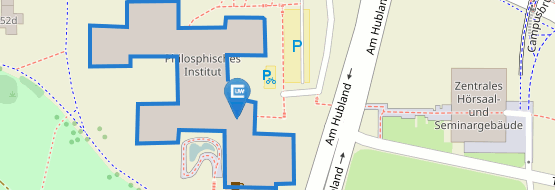Aktuelle Lehrveranstaltungen
Vorlesungszeit: Beginn am 28.04.2025 (18. KW)
|
| | |
| |
08.00 bis |
| Wintjes |
| ||
| 10.00 bis 12.00 Uhr |
|
| Wintjes Monson | Monson | Kreis |
12.00 bis | Walter Proseminar Publius Clodius Pulcher: „Affe“, „Transvestit“, Volkstribun (3.37) |
| Heller | Kreis/Ó Dúill Tutorium zum Proseminar Einzeltermine, s. WueCampus (3.37) | |
14.00 bis | Li | Wintjes | Janosch | Monson Li | Osmers/Heßler/Glüer Projekt |
16.00 bis 18.00 Uhr | Wintjes | Osmers Proseminar Wintjes Seminar Einführung in die Konfliktsimulation | Monson
| Heller Proseminar Antoninus Pius – ein Pazifist auf dem Kaiserthron |
|
18.00 bis 20.00 Uhr | Wojciech | Osmers |
Vorlesung
Prof. Dr. Andrew Monson: Globalgeschichte zur Zeit des frühen Hellenismus (4./3. Jht. v. Chr.)
Mittwoch, von 16 bis 18 Uhr, Philosophiegebäude, Hörsaal 2 (Hubland Süd)
Im 4. und 3. Jahrhundert war die Welt so vernetzt wie nie zuvor. Das Achämenidenreich hatte seine Widerstandskraft über zwei Jahrhunderte lang von Libyen bis Zentralasien unter Beweis gestellt. Die nomadischen Skythen schufen Verbindungen von Europa bis China. Alexander der Große führte seine Armeen an die Donau, den Nil, den Syr-Darya und den Indus. Die Qin- und Han-Dynastien errichteten das erste chinesische Kaiserreich, während das Maurya-Reich einen Großteil Indiens beherrschte. Die westeuropäische Peripherie der kriegerischen Gallier und Römer wurde in ein eurasisches Netz eingebunden. Was Althistoriker als „Hellenismus“ bezeichnen, war nur ein Teil des umfassenderen globalen Phänomens, das Thema dieser Vorlesung sein wird.
Einführende Literatur:
- A. Chaniotis, Die Öffnung der Welt. Eine Globalgeschichte des Hellenismus, Darmstadt 2022
- B. Cunliffe, By Steppe, Desert, and Ocean: The Birth of Eurasia, Oxford 2015.
- M.E. Lewis, The Early Chinese Empires: Qin and Han, Cambridge, Mass. 2007.
- P.F. Mittag, Geschichte des Hellenismus, Berlin 2023.
- P. Thonemann, The Hellenistic Age, Oxford 2016.
Grundkurs
Prof. Dr. Jorit Wintjes: Grundkurs zur Alten Geschichte
Mittwoch, von 10 bis 12 Uhr , Philosophiegebäude, Hörsaal 2 (Hubland Süd)
Der Grundkurs gibt einen Überblick über die wichtigsten Epochen der Alten Geschichte und führt in Ereignis-, Gesellschafts-, Struktur- und Mentalitätsgeschichte der griechischen und römischen Welt ein.
Einführende Literatur:
- Elke Stein-Hölkeskamp, Das archaische Griechenland. Die Stadt und das Meer (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2015.
- Sebastian Schmidt-Hofner, Das klassische Griechenland. Der Krieg und die Freiheit (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2016.
- Peter Scholz, Der Hellenismus. Der Hof und die Welt (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2015.
- Wolfgang Blösel, Die römische Republik. Forum und Expansion (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2015.
- Armin Eich, Die römische Kaiserzeit. Die Legionen und das Imperium (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2014.
- Rene Pfeilschifter, Die Spätantike. Der eine Gott und die vielen Herrscher (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2018².
Proseminare
PD Dr. Maria Osmers: Die Welt Homers
Dienstag, von 16 bis 18 Uhr, Residenz (Südflügel), Raum 3.37
Die Schriften Homers – die Ilias und die Odyssee – sind die ältesten uns erhaltenen Texte in griechischer Sprache. Und nicht nur heute genießen die Epen eine hohe Wertschätzung, bereits in der Antike galten Homer und sein Werk vielen späteren Autoren als Referenzpunkte. Zugleich vermitteln die Epen aber auch einen Eindruck von den historischen Bedingungen im griechischen Raum zur Zeit ihrer Entstehung in der frühen Archaik.
Im Rahmen des Proseminars sollen den Studierenden Homer und sein Werk nähergebracht werden. Insbesondere sollen dabei mit Hilfe der homerischen Schriften die sozialen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der frühen archaischen Zeit erschlossen werden.
Einführende Literatur:
- M. Finley, Die Welt des Odysseus, München 1979.
- R. Fowler (Hrsg.), The Cambridge Companion to Homer, Cambridge 2004.
- R. Osborne, Greece in the making, 1200-479 BC., London/New York 2009².
- B. Patzek, Homer und seine Zeit, München 2009².
- E. Stein-Hölkeskamp, Das archaische Griechenland. Die Stadt und das Meer (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2015.
Prof. Dr. Jorit Wintjes: Kaiser Vespasian
Dienstag, von 14 bis 16 Uhr, Residenz (Südflügel), Raum 3.37
Aus dem Chaos des Vierkaiserjahres ging mit Vespasian der Begründer der Flavierdynastie als neuer Kaiser hervor. Die Aufgaben, vor denen er im Herbst des Jahres 69 stand, waren gewaltig: das Reich hatte nicht nur durch einen viele Monate dauernden Bürgerkrieg hinter sich, im Rahmen dessen es zu erheblichen Kampfhandlungen gekommen war, auch in Rom selbst war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und sogar zum Brand des Kapitols gekommen; dazu hatten die militärischen Anstrengungen des Vierkaiserjahres die kaiserliche Schatulle stark beansprucht, und Vespasian fehlte - abgesehen von seinem Sieg im Bürgerkrieg - jede dynastische Legitimation. Trotzdem gelang es ihm innerhalb weniger Jahre, seine Herrschaft so zu festigen, daß bei seinem Tod im Jahr 79 die Übernahme der Herrschaft durch seinen Sohn Titus völlig außer Frage stand. Im Mittelpunkt des Seminars stehen die verschiedenen Maßnahmen, mit denen Vespasian seine Herrschaft konsolidierte. Daneben führt das Seminar allgemein in Methoden und Arbeitsinstrumente der Alten Geschichte ein.
Einführende Literatur:
- Barbara Levick, Vespasian, Oxford 1997.
- Miriam Griffin, The Flavians, in: A.K. Bowman et al. (ed.), The High Empire, A. D. 70–192. Cambridge 2000, 1–83 [im Uninetz verfügbar].
- Stefan Pfeiffer, Die Zeit der Flavier. Vespasian, Titus, Domitian, Darmstadt 2009.
René Walter M.A.: Publius Clodius Pulcher: „Affe", „Transvestit“, Volkstribun
Montag, von 12 bis 14 Uhr, Residenz (Südflügel), Raum 3.37
Publius Clodius Pulcher gehört sicherlich zu den schillerndsten Persönlichkeiten der späten Republik. Dies spiegelt sich in der Varietät der wissenschaftlichen Bewertung wider: „Affe“ (Mommsen), „Gangster“ (Marsh), Reformpolitiker (Will), Opportunist (Spielvogel), „Transvestit“ (Sommer). Das Seminar möchte die Biografie des P. Clodius Pulcher selbst beleuchten als auch dessen politisches Handeln, insbesondere sein Volkstribunat. Dabei wird das persönliche Verhältnis zu Cicero und vice versa eine Rolle spielen sowie die turbulenten 50er Jahre der späten Republik. Neben der inhaltlichen Komponente des Seminars wird allgemein in die Arbeitsmethoden und Hilfswissenschaften der Alten Geschichte eingeführt.
Einführende Literatur:
- Herbert Benner, Die Politik des P. Clodius Pulcher. Untersuchungen zur Denaturierung des Clientelwesens in der ausgehenden Römischen Republik, Stuttgart 1987.
- Wolfgang Blösel, Die römische Republik. Forum und Expansion (C. H. Beck Geschichte der Antike), München 2015.
- Michael Sommer, Volkstribun. Die Verführung der Massen und der Untergang der Römischen Republik, Stuttgart 2023.
- Jeffrey W. Tatum, The Patrician Tribune. Publius Clodius Pulcher, Chapel Hill 1999.
PD Dr. André Heller: Philipp V. und seine Zeit
Donnerstag, von 12 bis 14 Uhr, Residenz (Südflügel), Raum 3.37
Um das Jahr 222 v. Chr. vollzogen sich in den drei hellenistischen Großreichen Herrscherwechsel, welche die politischen Entwicklungen des Mittelmeerraums entscheidend beeinflussen sollten. Ptolemaios IV. (221–204) in Ägypten, Antiochos III. (223–187) im Seleukidenreich und Philipp V. (221–179) in Makedonien betrieben eine äußerst ambitionierte Außenpolitik. Letzterer geriet durch seine Westpolitik – darunter ein Bündnis mit Hannibal – in einen Konflikt mit der römischen Republik, die schließlich nicht nur über Philipp, sondern auch über Antiochos triumphieren sollte. Das Seminar will nicht nur die politischen Entwicklungen anhand der Quellen nachzeichnen, sondern auch Phänomene wie den hellenistischen Königshof, die diplomatischen Gepflogenheiten und die Strukturen des makedonischen Reiches in den Blick nehmen.
Daneben führt das Seminar allgemein in Methoden und Arbeitsinstrumente der Alten Geschichte ein; außerdem werden Techniken zum korrekten Abfassen einer Wissenschaftlichen Hausarbeit vermittelt.
Einführende Literatur:
- A. M. Eckstein, Rome Enters the Greek East. From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230–170 BC, Malden, MA/Oxford 2012.
- M. Kleu, Die Seepolitik Philipps V. von Makedonien, Bochum 2015.
- E. Nicholson, Philip V of Macedon in Polybius’ Histories. Politics, History, and Fiction, Oxford 2023.
- R. Pfeilschifter, Titus Quinctius Flamininus. Untersuchungen zur römischen Griechenlandpolitik, Göttingen 2005.
- F. W. Walbank, Philip V of Macedon, Cambridge 1940.
PD Dr. André Heller: Antonius Pius - ein Pazifist auf dem Kaiserthron?
Donnerstag, von 16 bis 18 Uhr, Residenz (Südflügel), Raum 3.37
Seinen Zeitgenossen galt Antoninus Pius (138–161) als „Friedensfürst“, der von Rom aus das Reich regierte. Die ältere Forschung warf ihm jedoch – neben der durchaus anerkennenden Bewertung seiner administrativen und juristischen Tätigkeit – Versäumnisse in der Außenpolitik vor, welche die schwere Krise des Imperium Romanum unter seinen Nachfolgern heraufbeschworen habe. Die jüngere Forschung hingegen machte darauf aufmerksam, dass Antoninus eine nicht geringe Zahl an Kriegen führte, sodass er kaum als „Pazifist“ zu bezeichnen sei. Das Seminar will anhand der schriftlichen wie nicht-literarischen Quellen zu einer ausgewogenen Sicht auf Antoninus Pius und seine Politik gelangen. Zudem lassen sich exemplarisch die kaiserliche Nachfolgeregelung, die Erwartungen an einen Kaiser und die Verwaltungspraxis der Hohen Kaiserzeit untersuchen.
Daneben führt das Seminar allgemein in Methoden und Arbeitsinstrumente der Alten Geschichte ein; außerdem werden Techniken zum korrekten Abfassen einer Wissenschaftlichen Hausarbeit vermittelt.
Einführende Literatur:
- G. Aumann, Antoninus Pius. Der vergessene Kaiser, Wiesbaden 2019.
- C. Michels, Antoninus Pius und die Rollenbilder des römischen Princeps. Herrscherliches Handeln und seine Repräsentation in der Hohen Kaiserzeit, Berlin/Boston, MA 2018.
- R. Hund, Studien zur Außenpolitik der Kaiser Antoninus Pius und Marc Aurel im Schatten der Markomannenkriege, Rahden 2017.
- W. Hüttl, Antoninus Pius, 2 Bdd., Prag 1933/1936.
- O. Schipp, Die Adoptivkaiser, Darmstadt 2011.
Hauptseminare - Ausgewählte Probleme der Alten Geschichte
Prof. Dr. Jorit Wintjes: Der Erste Punische Krieg
Montag, von 16 bis 18 Uhr, Lehrstuhl für Alte Geschichte, Residenz (Südflügel), HS 1 der Residenz.
Der Erste Punische Krieg ist die erste große Auseinandersetzung zwischen Rom und Karthago. Auf drei Schauplätzen - der See, Sizilien und Nordafrika - ringen die beiden Kontrahenten um die Vorherrschaft im zentralen Mittelmeerraum, am Ende wird Rom siegreich aus einem der längsten Kriege herausgehen, den es bis zu diesem Zeitpunkt zu bestehen hatte. Insbesondere die hohen Verluste hinterlassen im kollektiven Gedächtnis der römischen Gesellschaft bleibende Eindrücke und werden das weitere Verhältnis zu Karthago prägen.
Im Mittelpunkt des Seminars stehen neben dem eigentlichen Kriegsverlauf auch die Vor- und Rezeptionsgeschichte des Konfliktes.
Literatur:
- N. Bagnall, The Punic Wars, New York 1990.
- D. Hoyos (ed.), A Companion to the Punic Wars. Oxford, 2011.
Prof. Dr. Andrew Monson: Antike Demokratie
Donnerstag, von 10 bis 12 Uhr, Lehrstuhl für Alte Geschichte, Residenz (Südflügel), Raum 3.37
Das klassische Athen war die Wiege der Demokratie, aber wie einzigartig war seine Verfassung? In diesem Seminar analysieren wir athenische Institutionen und vergleichen sie mit anderen Fällen partizipativer Selbstverwaltung in der Antike und darüber hinaus. Diese unterscheiden sich in der Exklusivität der Bürgergemeinschaft, in den Rechten und Pflichten der Bürger, im Vertrauen auf Mehrheitsentscheidungen sowie in der Bereitschaft, Autorität zu delegieren und ihren Missbrauch zu verhindern. Anhand dieses historischen Vergleichs werden wir verschiedene klassische und moderne Theorien zur Gestaltung und Klassifizierung von demokratischen Verfassungen bewerten.
Literatur:
- Aristoteles, Politik und Staat der Athener.
- M. H. Hansen, Die athenische Demokratie im Zeitalter des Demosthenes : Struktur, Prinzipien und Selbstverständnis, Berlin 1995.
- E. Robinson, Democracy Beyond Athens: Popular Government in the Greek Classical Age, Cambridge 2011.
- E. Flaig, Hrsg. Genese und Dynamiken der Mehrheitsentscheidung, München 2013.
- M. Schwartzberg, Counting the Many: The Origins and Limits of Supermajority Rule, Cambridge 2013.
- D. Stasavage, The Decline and Rise of Democracy: A Global History from Antiquity to Today, Princeton 2020.
Oberseminar
PD Dr. Katharina Wojciech: Oberseminar zur Alten Geschichte
Montag, von 18 bis 20 Uhr – Lehrstuhl für Alte Geschichte, Residenz, Raum 3.37
Das Seminar dient der Vorstellung und Diskussion von Qualifikationsarbeiten sowie kleinerer und größerer Forschungsprojekte. Ich bitte um persönliche Anmeldung in der Sprechstunde.
Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft
Prof. Dr. Andrew Monson: Empires in Comparative Perspective
Mittwoch, von 10 bis 12 Uhr, Philosophiegebäude (Hubland), Übungsraum 18
Few topics in comparative history have received more attention in both popular and scholarly discourse in the last several decades than empires. In contrast to the nations and cultures that structure modern historiography, empires shed light on the processes of globalization in the human past and the historical antecedents for the supernational and hegemonic powers that shape global politics today. In this course, we will discuss theories and methods that historians use to compare empires, focusing on premodern empires, and will read case studies that highlight their characteristics and dynamics.
Einführende Literatur:
- P.Bang, C.A. Bayley, W. Scheidel, Hrsg. The Oxford World History of Empire, 2 Bd. Oxford 2021.
- M. Gehler, R. Rollinger, Hrsg. Imperien und Reiche in der Weltgeschichte: Epochübergreifende und globalhistorische Vergleiche, 2 Bd. Wiesbaden 2014.
- S.E. Alcock, T.N. D’Altroy, K.D. Morrison und C.M. Sinopoli, Hrsg. Empires. Cambridge 2001.
Leistungsnachweis:
Regelmäßige Teilnahme, Referat mit Thesenpapier (sowie ggf. schriftliche Hausarbeit).
Prof. Dr. Andrew Monson: Die Politik des Aristoteles
Donnerstag, von 14 bis 16 Uhr, Residenz, 3.37.
Aristoteles stützt sich in der Politik auf umfangreiche Untersuchungen zu den Verfassungen seiner Zeit. Sein Werk enthält nicht nur eine Fülle von Informationen für Historiker, sondern ist auch ein Grundlagentext für die vergleichende Politikwissenschaft. In dieser Übung werden wir den Text in Übersetzung lesen und diskutieren. Besonderes Augenmerk werden wir dabei auf seine Vorstellungen von Bürgerrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie auf den historischen Kontext des vierten Jahrhunderts v. Chr. legen.
Einführende Literatur:
- E. Schütrumpf, Aristoteles. Politik, Berlin 1991-2005 (Buch I, 1991, Buch II/III, 1991, Buch IV-VI [mit H.-J. Gehrke] 1996, Buch VII/VIII 2005).
- F.D. Miller, Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics, Oxford 1995.
- A. Lintott, Aristote’s Political Philosophy in its Historical Context: A New Translation and Commentary on Books 5 and 6, London 2018.
Leistungsnachweis:
Regelmäßige Teilnahme, Referat mit Thesenpapier (sowie ggf. schriftliche Hausarbeit).
Maria Janosch M.A.: Von Ninive bis Pergamon - Herrschaftsrepräsentation in Kleinasien im 1. Jahrtausend v. Chr.
Mittwoch, von 14 bis 16 Uhr, Residenz (Südflügel), Raum 3.37
Herrscher:innen kommunizieren; sei es um sich zu legitimieren, zu rechtfertigen oder zur Schau zu stellen. Anhand ausgewählter Quellen gibt diese Übung einen Überblick über die verschiedenen Ausprägungen herrscherlicher Selbstrepräsentation bis in den Hellenismus. Ziel ist es, die Probleme im Umgang mit Quellen zu erkennen und kritisch zu überdenken, sowie den Umgang mit wissenschaftlicher Literatur und wissenschaftlichem Schreiben zu erlernen.
Einführende Literatur:
- Cancik-Kirschbaum, Eva: Die Assyrer - Geschichte, Gesellschaft, Kultur, 3. Aufl., München, 2015.
- Wiesehöfer, Josef: Das frühe Persien - Geschichte eines antiken Weltreichs, 6. Aufl., München, 2021.
- Llewellyn-Jones, Lloyd: Persians - The Age of the Great Kings, London, 2022.
- Fuchs, Andreas: Der Turtan Šamši-Ilu und die große Zeit der assyrischen Großen (830-746), Welt des Orients 38, 2008, S. 61-145.
- Meister, Jan: Antike und moderne Propaganda, in: Historische Zeitschrift 312, 2021.
- Blum, Hartmut/Wolters, Reinhard: Alte Geschichte studieren, 2. Aufl., Konstanz, 2011.
- Streck, Michael: Altorientalistik - Einführung, Baden-Baden, 2023.
- Gehrke, Hans-Joachim: Der siegreiche König - Überlegungen zur Hellenistischen Monarchie, in: Archiv für Kulturgeschichte, 1982, S. 247-277.
- Wiemer, Hans-Ulrich: Siegen oder Untergehen? Die hellenistische Monarchie in der neueren Forschung, in: Rebenich, Stefan (Hrsg.): Monarchische Herrschaft im Altertum, Berlin/Boston, 2017, S. 305-339.
- Lane Fox, Robin: Alexander the Great - ‚Last of the Achaemenids‘, in: Tulpin, C. (Hrsg.): Persian Responses - Political and cultural interaction (with)in the Achaemenid Empire, Swansea, 2008, S: 267-312.
- Wiemer, Hans-Ulrich: Alexander - Der letzte Achaimenide? Eroberungspolitik, lokale Eliten und altorientalische Traditionen im Jahr 323, in: HZ 284, 2007, S. 281-309.
Hinweise:
Auf Grund thematischer Überschneidungen ist eine Teilnahme für Studierende der Altorientalistik ausschließlich in dieser Parallelgruppe möglich. Sprachkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.
Leistungsnachweis:
Regelmäßige Teilnahme, Essay.
Dr. Xiang Li: Pnformation Management in Ancient Empires: From Messages to Ideology
Montag, von 14 bis 16 Uhr, Philosophiegebäude (Hubland), Übungsraum 20.
The study of information has become crucial to our understanding of human history. The management of information—the organization, encoding, storage, retrieval, and application of it—is of fundamental importance to the making of a specific civilization. This course aims to introduce students to an array of recent scholarship on the forming of a series of “quasi-informational empires” from the sixth century BCE to Late Antiquity, by using a comparative perspective. Special attention will be paid to three geographical areas: East Asia, the Iranian plateau, and the Mediterranean region. In addition to examining the relationship between information and realpolitik, we will also encounter how individuals and groups interacted with information in social domains that seemed less relevant to statecraft: financial investment, aesthetic appreciation, daily rituals, medical treatment, and so forth. All these activities are astonishing to modern people not only because of the amount of information involved in them, but also because of the proliferation of institutions that transferred such information into the basis of certain types of ideology.
Three groups of questions will be discussed in this course: (i) How was information used as a device for sustaining social order, and how was it employed as a tool for revolutionary movements and political resistance? (ii) In what sense was information an architect of interpersonal relationships and social ties? How did information come to have ethical and aesthetic meanings in given circumstances? (iii) What were the connections between information, politics, economy, art, literature, and religion? Were there “information revolutions” in the ancient past? By responding to these questions, students will obtain the opportunity to engage in curious conversations between ancient and modern, between history studies and other disciplines, and between theoretical contemplation and real-life experience.
Einführende Literatur:
- Harold D. Lasswell, Daniel Lerner and Hans Speier eds., Propaganda and Communication in World History: Vol. 1, The Symbolic Instrument in Early Times (University Press of Hawaii, 1979).
- Charles Sanft, Communication and Cooperation in Early Imperial China: Publicizing the Qin Dynasty (SUNY Press, 2013).
- Andrew M. Riggsby, Mosaics of Knowledge: Representing Information in the Roman World (Oxford, 2019).
Leistungsnachweis:
Regelmäßige Teilnahme, Referat mit Thesenpapier (sowie ggf. schriftliche Hausarbeit).
Dr. Xiang Li: City-States in Comparative Perspective
Donnerstag, von 14 bis 16 Uhr, Philosophiegebäude (Hubland), Übungsraum 8.
What does China’s remote past mean for her present and future? What rules do scholars often follow in writing about such a distant epoch? Can carrying out close investigations of extant materials lead to a sound understanding of that period of time? Starting from these basic inquiries, this course introduces students to important topics and problems in the existing scholarship of early Chinese history and civilization (ca. 18th century BCE–3rd century CE). No previous knowledge of Chinese is required.
Our first goal will be to identify how researchers have defined and categorized primary sources. What are the standards for “reliable sources”? Is “reliable” a fixed label, or actually multilayered? How have the criteria for “reliable sources” changed over time in the field of early China studies? The second goal is to examine how scholars have conceptualized some of the key components of early Chinese history. How have those paired concepts like guó 國 (state) and jiā 家 (household), gōng 公 (public) and sī 私 (private), shén 神 (deities) and guǐ 鬼 (ghosts) become so important in this field? How have discussions on these key notions changed over time? The third goal is to study how scholars have thought about their discipline: What theories and thinking paradigms about “early China” have they contributed? How have these theories and paradigms shifted over time? What questions are considered as “frontline”/“cutting-edge” in this field nowadays, and why? The last goal of this course is to explore what we might call the sociology of the discipline of early China studies. Who seem to be the most prominent voices in the field? Why do they draw our attention? How do they debate with each other? How do they all relate together? In this way, the course touches on aspects of disciplinarity, positionality and institutionalization, which together constitute a broad realm—the socio-cultural history of “Studies in Early China.”
Einführende Literatur:
- Michael Loewe and Edward L. Shaughnessy eds., The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of Civilization to 221 BC (Cambridge, 1999).
- John K. Fairbank and Denis C. Twitchett eds., The Cambridge History of China, Volume 1: The Ch’in and Han Empires, 221 B.C. - A.D. 220 (Cambridge, 1986).
- K.C. Chang, The Archaeology of Ancient China, 4th edition (Yale University Press, 1986).
- Anne Underhill ed., A Companion to Chinese Archaeology (Blackwell, 2013).
Leistungsnachweis:
Regelmäßige Teilnahme, Referat mit Thesenpapier (sowie ggf. schriftliche Hausarbeit).
Prof. Dr. Jorit Wintjes: Das mykenische Griechenland
Montag, von 14 bis 16 Uhr, Residenz (Südflügel), Raum 3.36
Die Griechische Geschichte beginnt in der Bronzezeit mit dem Auftreten der sogenannten mykenischen Palastzivilisation. Die Übung wird diese sowie ihre Beziehungen zu Nachbarzivilisationen in den Blick nehmen; ein Schwerpunkt wird dabei auf der Auseinandersetzung mit den Linear-B-Texten liegen, bei denen es sich um die ältesten erhaltenen griechischen Sprachzeugnisse und damit die ersten Textquellen der Alten Geschichte handelt.
Einführende Literatur:
- Stefan Hiller; Oswald Panagl, Die frühgriechischen Texte aus mykenischer Zeit, Darmstadt 1986.
- Michael Ventris; John Chadwick, Documents in Mycenaean Greek. Three hundred selected tablets from Knossos, Pylos and Mycenae with commentary and vocabulary, Cambridge 1973.
Interdisziplinäres Projekt
PD Dr. Maria Osmers, PD Dr. Jan Erik Heßler. Anton Glüer: KI-gestützte Lehrvideos zur griechisch-römischen Antike: Potentiale und Grenzen digitaler Tools
Blockveranstaltung
Das Projektseminar ist interdisziplinär ausgerichtet und richtet sich an Studierende mehrerer Fächer (Geschichte, Griechisch, Latein). Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam den Nutzen von KI-Tools für das Studium kritisch zu erproben und auf Grundlage der Ergebnisse, digitale Ressourcen für die Lehre zu erarbeiten.
Digital Humanities
Florian Kreis: Wissenschaftliches Arbeiten
Freitag, 18.10., 25.10., 08.11., 15.11., von 8 bis 12 Uhr, online
In der Lehrveranstaltung wird an ausgewählten Beispielen in die Methodik des Faches Geschichte eingeführt. Dabei werden die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens und die Präsentation von Arbeitsergebnissen behandelt. Der Kurs richtet sich insbesondere an Studenten des ersten Semesters. Lehramtsstudenten können sich den Kurs für den freien Bereich anrechnen lassen.
Florian Kreis / Teresa Ó Dúill: Tutorium zum Proseminar
Einzeltermine, Bekanntgabe über WueCampus!
Das Tutorium vermittelt begleitend zum Seminar allgemeine Kenntnisse zur Alten Geschichte, bietet anhand ausgewählter Beispiele einen Überblick über die fachspezifischen Hilfsmittel und Methoden der Alten Geschichte und zeigt die Interdependenzen mit anderen geisteswissenschaftlichen Teildisziplinen auf. Die Veranstaltung findet als hybrides Format statt und besteht aus digitalen Lerneinheiten und Treffen in Präsenz. Die Anmeldung erfolgt über Wue-Campus, Details zur Einschreibung werden auch in den Seminaren des Aufbaumoduls bekannt gegeben; weitere Informationen zu Terminen und Ablauf finden Sie im WueCampus-Raum
>> zurück zur Übersicht